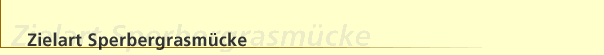
STECKBRIEF Sylvia nisoria
| Größe: | 15 cm |
| Färbung: | bräunlich-grau, Unterseite weißlichgrau quergewellt |
| Kennzeichen: | leuchtend gelbe Iris |
| Nahrung: | Insekten, Beeren, Obst |
| Brutzeit: | Mitte Mai-Ende August |
| Gelege: | 4-5 Eier |
| Bebrütung: | 12-14 Tage |
| Nestlingsdauer: | 11-15 Tage |
| Tierstimme: |
Gesang der Sperbergrasmücke, MP3, 250 KB mit freundlicher Unterstützung von Jean Roché - www.ceba.fr |
Lebensweise
Die Sperbergrasmücke ist ein Langstreckenzieher, deren Winterquartier in Ostafrika liegt. Der Heimzug in die Brutgebiete erfolgt Ende April bis Mai. Nach der Ankunft ist ihre Gesangsaktivität am höchsten. Auffällig sind ihre Singflüge (das Auffliegen über dem Gebüsch mit gleichzeitigem Gesang) und ihr ratternder Warnruf. Mit Beginn der Brutphase ist sie kaum noch zu bemerken. Sie nutzt das ausgeprägte Warn- und Verteidigungsverhalten des Neuntöters aus und teilt deswegen häufig das Revier mit ihm. Männchen und Weibchen bauen das Nest gemeinsam in dornigen Gebüschen. Bevorzugt werden Schlehe und Weißdorn genutzt. Die Jungen werden von beiden Eltern mit Insekten und Beeren aufgezogen. Der Wegzug erfolgt meist im August.
Lebensraum
Die Sperbergrasmücke bevorzugt hecken- und gebüschreiche Lebensräume in warmer, trockener Lage. Die dornigen Gestrüppe sind Hauptaufenthaltsort, Nahrungsrevier und Brutplatz. Das Nest wird meist in dornigen Büschen angelegt. Als Singwarten und Ausgangspunkte für Balzflüge dienen Einzelbäume.
Gefährdung
Die Sperbergrasmücke verträgt keine feuchten und kühlen Frühsommer. Daher treten selbst in optimalen Habitaten, klimatisch bedingt, deutliche Bestandsschwankungen auf. Zusätzlich haben aber auch Lebensraumverluste durch Beseitigung von Hecken und Büschen, der Einsatz von Bioziden und die Intensivierung der Landwirtschaft mit verstärkter Nutzung von Ruderalflächen, Trocken- und Magerrasen negative Auswirkungen auf die Art. Daher gilt die Sperbergrasmücke bundesweit als stark gefährdet.
Situation der Sperbergrasmücke auf den Flächen des Demeterhofes Ökodorf Brodowin
Die Bestandsaufnahme ergab eine Dichte von 4 Brutpaaren / 100 ha Ackerfläche. Im Vergleich dazu wurde im Unteren Odertal eine Siedlungsdichte von 2 Revieren / 100 ha festgestellt.