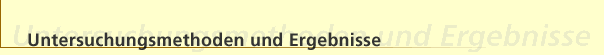
Amphibienmonitoring
Die durchschnittliche Kleingewässerdichte der ackerbaulich genutzten Betriebsfläche beträgt 4,5 Kleingewässer pro 100 ha. Die vom Betrieb bewirtschafteten Ackerflächen des ausgewiesenen FFH-Gebietes "Brodowin-Oderberg" sind durch eine höhere Gewässerdichte von 7 – 8 Gewässern pro 100 ha (Gesamtfläche 256 ha) gekennzeichnet. Damit erreicht dieser Teilbereich den Wert von 8 – 10 Gewässern, der von Experten als Reproduktionszentrum für Amphibien bezeichnet wird.
Für das Monitoring der Amphibien wurden 26 repräsentative Gewässer der Betriebsfläche, die sich auf Ackerflächen befinden oder an diese angrenzen, ausgewählt. Die untersuchten Gewässer bestehen aus den gebietstypischen und im Pleistozän entstandenen Söllen und anderen Kleinstgewässern, zusätzlich werden, in Abhängigkeit von ihrem Vorkommen, schlaginterne Ackernassstellen überwacht.
Methodisches Vorgehen
Zur Erfassung der Bestandsgrößen wird an allen Gewässern 1-2 Mal während der Laichzeit eine Tag- und Nachtkartierung aller rufenden Individuen durchgeführt.
Um gute Aussagen zu Amphibienpopulationen zu treffen ist es jedoch auch unerlässlich, Daten zur Reproduktion zu erhalten. Wesentlich ist hierbei die Erfassung von Laichgewässern. Da Amphibien nicht in allen Gewässern in denen sie rufen auch ablaichen, wurden werden Amphibienlarven mithilfe eines Keschers nachgewiesen. Um die Nachweisbarkeit von Amphibienlarven zu verbessern, wurden an ausgewählten Gewässern zusätzlich Lichtfallen zum Fang der Larven eingesetzt.
Die Lichtfallen wurden von der Naturwacht des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin leihweise zur Verfügung gestellt.

Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Reproduktion
Zusätzlich zu den Zielarten Laubfrosch, Rotbauchunke und Knoblauchkröte wurden auch weitere Amphibienarten festgestellt. Besonders häufig waren dabei Moorfrösche, aber auch Grasfrösche, Wasserfrösche, Erdkröten, Teich- und Kammmolche konnten als Alt- und Jungtiere nachgewiesen werden. Die Anzahl von den Zielarten besiedelter Gewässer schwankt sehr stark zwischen den Jahren, .ebenso der Anteil von Laichgewässern an der Gesamtzahl von Rufgewässern. 2003 trockneten viele Laichgewässer bereits früh aus, so dass die vergleichsweise geringe Reproduktionsrate dieses Jahres teilweise auf der Witterung beruht. Der Laubfrosch war die häufigste Zielart. Die Rotbauchunke besaß in den beiden ersten Untersuchungsjahren einen für diese Art sehr hohen Anteil an Laichgewässern.
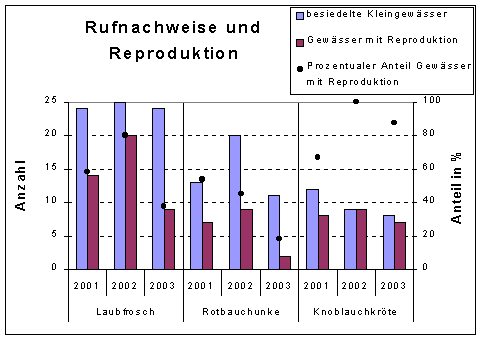
Die Größe der Rufgemeinschaften ist ein Indikator für die Lebensraumqualität und Populationsstabilität der untersuchten Arten (große Rufgemeinschaft = positiv).. Tendenziell ist im Untersuchungsgebiet beim Laubfrosch und bei der Rotbauchunke eine Häufung größerer Rufgemeinschaften und eine Abnahme kleiner Rufgemeinschaften zu verzeichnen. Die Analyse der Rufgemeinschaften ist für Knoblauchkröten aufgrund ihrer leisen Rufe nicht effektiv möglich.
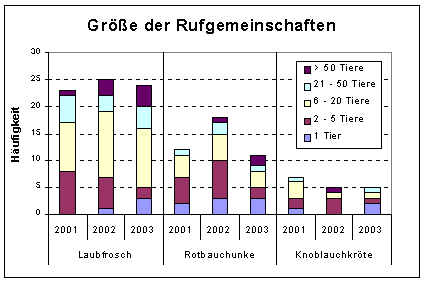
Amphibien-Wanderwege
Das Material für den Fangzaun wurde vom Landesumweltamt Brandenburg (Naturschutzstation Rhinluch) zur Verfügung gestellt. Der 360 m lange Folienzaun wurde zum effektiveren Nachweis von Laubfröschen mit einem beidseitigen Überkletterschutz versehen. Die Fangeimer wurden, ebenso für den Laubfroschfang präpariert, an beiden Seiten des Zaunes im Abstand von 10 Metern eingegraben.
Zum Schutz des Wanderkorridors wurde auf dieser Fläche ein extensiv genutzter Gewässerrandstreifen angelegt.

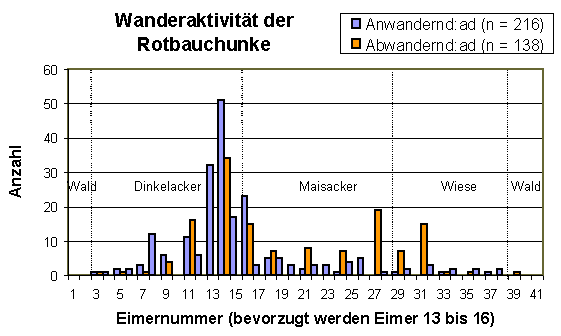
Gewässergüteuntersuchung
Bis auf ein Gewässer gewährleistet die Gewässergüte immer die Entwicklung von Amphibienlarven. Die fehlende Reproduktion muss daher auf anderen Gründen beruhen.
Massnahmen zur Förderung von Amphibien
Erfolgskontrolle der naturschutzfachlich optimierten Nutzung der Gewässerrandbereiche:
Die jährlichen Erfolgskontrollen ergaben in Abhängigkeit vom Schnitttermin unterschiedlich starke Beeinträchtigungen der Amphibienfauna. Während die Mahd im Mai keinerlei Auswirkungen zeigte, wurden nach der Mahd im Frühsommer die gemähten Flächen gemieden.
Während der Ruheperiode ab Juli konnte auf den Randstreifen eine hohe Wanderaktivität vieler Jungamphibien aber auch von einzelnen Alttieren festgestellt werden. Folgende Arten waren vertreten: Laubfrosch, Rotbauchunke, Knoblauchkröte, Moorfrosch, Grünfrosch, Erdkröte, Teichmolch, Kammmolch. Alle diese Arten profitierten von diesem Nutzungssystem.
2. Verbesserung des Amphibienlebensraumes durch Gehölzentfernung im Südbereich
von Gewässern

Im Winter 2001/2002 und 2002/2003 wurden am Südrand zweier Gewässer, an denen keine bzw. nur geringe Fortpflanzung stattfand, Weidengebüsche und Erlen entfernt. Die dadurch erreichte bessere Besonnung führt zu einer schnelleren Erwärmung des Wassers und damit besseren Entwicklungsbedingungen für Amphibienlarven und erhöhte dadurch so die Attraktivität der Gewässer für ablaichende, wärmeliebende Arten.
Erfolgskontrolle:
Die Gehölzentfernung am Südrand von Amphibiengewässern hatte sehr positive Auswirkungen auf unsere Zielarten. Außerdem profitierten auch Kamm- und Teichmolche von dieser Maßnahme.
Die zukünftige Entwicklung dieser Gewässer wird in den nächsten Jahren weiterverfolgt.
| Soll am Brodowinsee auf Kirchenland | Trompeterbergbruch | |
| Vor der Maßnahme | Laubfrösche nur rufend Knoblauchkröte: < 10 Jungtiere |
Laubfrösche, Rotbauchunken, Knoblauchkröten nur rufend |
| Nach der Maßnahme | Laubfrosch: > 50 Jungtiere Knoblauchkröte: > 50 Jungtiere |
Laubfrosch: > 100 Jungtiere Knoblauchkröte > 50 Jungtiere Rotbauchunke < 10 Jungtiere |